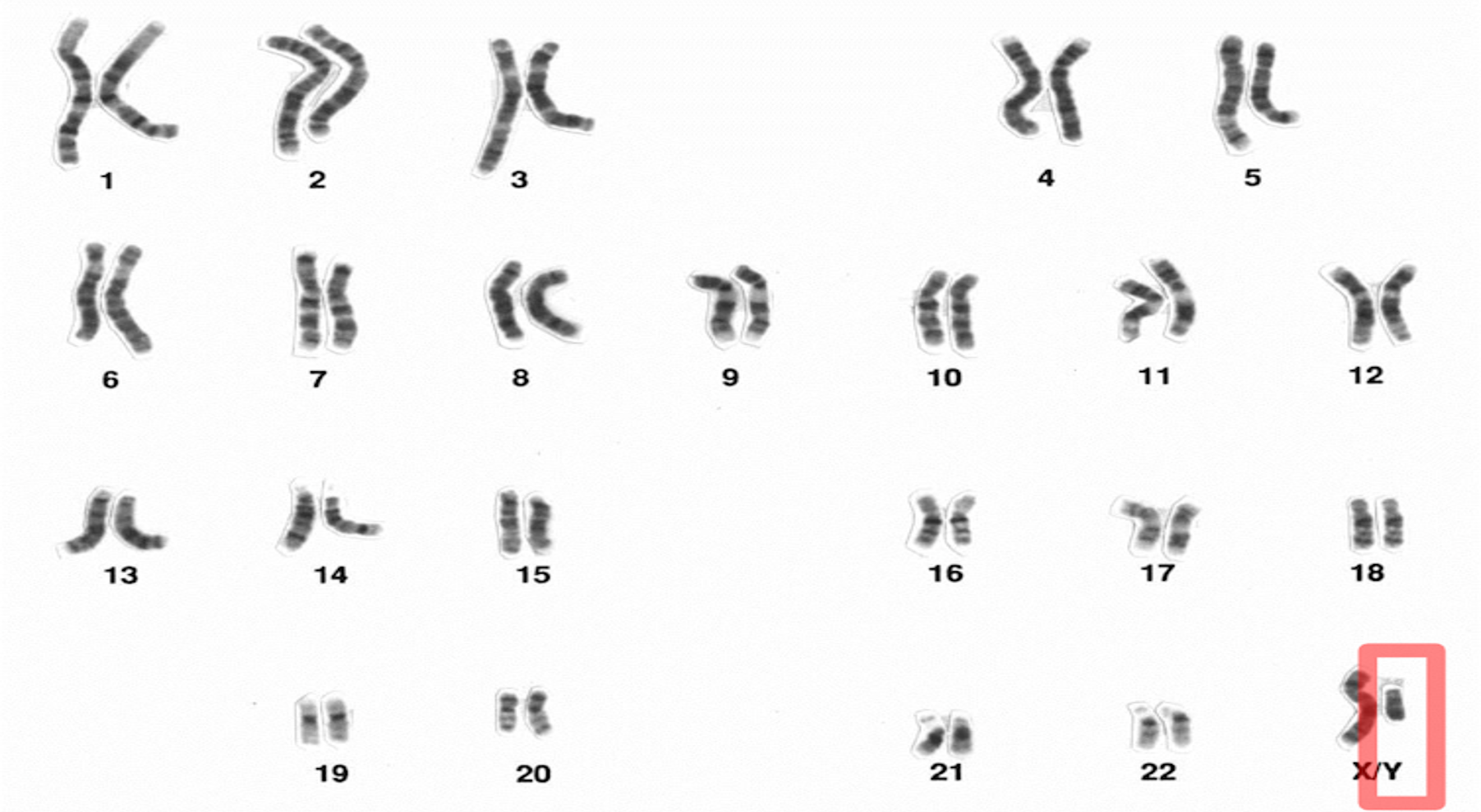![]()
von Jan Körner, Niklas Schenck, Christian Baars
Die deutschen Universitätskliniken sollen heilen und forschen. Sie sehen sich selbst als „Innovationsmotor“. Doch offenbar nehmen sie auch an Studien teil, deren Sinn umstritten ist, die aber finanziell lukrativ sein können: sogenannte Anwendungsbeobachtungen. Dies sind Studien, die nach der Zulassung eines Medikaments durchgeführt werden. Auftraggeber sind in der Regel Pharma-Unternehmen. Sie zahlen den Kliniken Geld dafür, dass sie Daten zum Einsatz eines Medikaments weitergeben – Daten, die sie ohnehin routinemäßig bei der Behandlung von Patienten erheben, wie etwa Laborwerte, Angaben zur Dosierung des Mittels oder zu möglichen Nebenwirkungen.
100 Millionen pro Jahr für Anwendungsbeobachtungen
Wie viel Geld für Anwendungsbeobachtungen gezahlt wird, verraten allerdings meist weder die Kliniken noch die Pharma-Unternehmen. Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ in Kooperation mit „correctiv.org“ haben jetzt eine Reihe solcher Vereinbarungen zutage gefördert und öffentlich zugänglich gemacht. Demnach bekommen Ärzte beziehungsweise Kliniken meist Hunderte, teils sogar mehr als 1.000 Euro pro Patient. Die Pharma-Industrie zahlt jährlich in Deutschland etwa 100 Millionen Euro an Honoraren für diese Art von Studien.
Vorwurf: Legale Korruption
Anwendungsbeobachtungen sind wegen dieser Honorare sehr umstritten. Kritiker beurteilen einen Großteil der Studien als eine Art legale Korruption. Das Uniklinikum Dresden erwähnt sie sogar explizit in seiner Anti-Korruptionsrichtlinie: „Mit der Durchführung von Anwendungsbeobachtungen verfolgen Pharma-Unternehmen überwiegend marketingbezogene Ziele, sodass dabei häufig der wissenschaftliche Wert verloren geht.“ Sie seien deshalb „grundsätzlich nicht erwünscht“, heißt es dort. Die meisten anderen Unikliniken in Deutschland sehen das aber nach Recherchen von Panorama 3, WDR, SZ und correctiv.org offenbar anders. Fast alle nehmen an Anwendungsbeobachtungen teil, so auch alle norddeutschen.
Wissenschaftlich uninteressant
Ein Beispiel: Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg. Es teilte auf Anfrage mit, es habe zwischen 2009 und 2014 an insgesamt rund 90 Anwendungsbeobachtungen teilgenommen. Wie viel Geld das Klinikum damit eingenommen hat, wollte das UKE nicht sagen. Auch auf Fragen zum Sinn dieser Studien gab es keine Antwort. Dabei bezweifeln viele Experten den wissenschaftlichen Nutzen von Anwendungsbeobachtungen. „Die Ergebnisse interessieren eigentlich niemanden“, sagt etwa Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG). Denn anders als bei klinischen Studien gibt es bei Anwendungsbeobachtungen in der Regel keine Vergleichsgruppe. Das heißt, niemand kann beurteilen, was passiert wäre, wenn die Patienten kein Medikament bekommen hätten oder ein anderes. Aus seiner Sicht sind das Geld und die investierte Zeit für Anwendungsbeobachtungen sinnlos verschwendet.
Trotz mehrfacher Anfrage teilte das UKE nicht einmal mit, an welchen Anwendungsbeobachtungen es sich beteiligt. Einzelne Hinweise sind jedoch auf den Internetseiten des Klinikums zu finden – zum Beispiel, dass das UKE an der Anwendungsbeobachtung „Avanti“ teilnimmt, zum Medikament Avastin bei der Behandlung von Brustkrebspatientinnen. Laut den Unterlagen, die dem Recherche-Team vorliegen, zahlt der Hersteller Roche bis zu 1.100 Euro pro Patientin, allein 950 Euro davon im ersten Jahr, davon 200 Euro, wenn die Patientin einen Fragebogen ausfüllt. Auf Anfrage zu den Honoraren antwortete Roche: Die Höhe der Vergütung sei so bemessen, „dass kein Anreiz zur Verordnung eines Arzneimittels entsteht“.
„Gutes Geld für relativ leichte Arbeit“
„Es ist relativ gutes Geld für relativ leichte Arbeit“, sagt Sebastian Fetscher. Er ist Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und arbeitet als Onkologe in einer Lübecker Klinik. Er nehme nicht an Anwendungsbeobachtungen teil, denn er könne sich nicht vorstellen, dass ein Arzt von dem finanziellen Anreiz unbeeinflusst bleibe. Möglicherweise verführe er dazu, Patienten länger mit einem Mittel zu behandeln, als eigentlich nötig.
Und bei Avastin zur Brustkrebsbehandlung sieht Fetscher eine Anwendungsbeobachtung besonders kritisch. Denn das Medikament ist in diesem Bereich sehr umstritten. 2011 hat die amerikanische Zulassungsbehörde die Zulassung für Avastin zur Behandlung von Brustkrebs zurückgezogen. Das Mittel sei da „heroisch gescheitert“, sagt Fetscher. Die Frauen würden nicht länger überleben, gleichzeitig gebe es das Risiko von schweren Nebenwirkungen. „Ich vermute, die ganzen Anwendungsbeobachtungen bei Avastin verfolgen vor allem den Zweck, die Ärzte zu motivieren, Avastin häufiger einzusetzen“, kritisiert der Krebsspezialist Wolf-Dieter Ludwig vom Helios-Klinikum Berlin-Buch. Und das, „obwohl die Ergebnisse aus medizinischen Studien bei diesen Anwendungsgebieten wenig überzeugend sind“.
Warum das UKE im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung Brustkrebspatientinnen mit Avastin behandelt, ist unklar. Fragen dazu wurden nicht beantwortet. Der Hersteller Roche sagt, die Daten aus der täglichen Praxis seien eine „weitere, wichtige Quelle, um die Erkenntnisse hinsichtlich Wirksamkeit und Risiken aus den Zulassungsstudien zu erweitern“.
160.000 Euro für eine Studie, aber keine Antwort zum Zweck
Ein anderes, vor allem wegen seines hohen Preises umstrittenes Medikament ist Eylea von Bayer. Es wird eingesetzt zur Behandlung der Makuladegeneration, einer Augenerkrankung, an der viele ältere Menschen erblinden. Das Hamburger Universitätsklinikum UKE soll laut den Recherchen allein für die Teilnahme an einer aktuell laufenden Anwendungsbeobachtung zu Eylea etwa 160.000 Euro bekommen. Das UKE will sich auch hierzu nicht äußern. Der Hersteller Bayer sagt, er unterstütze das Projekt finanziell, „weil der mit den Ergebnissen dieser Studie verbundene Erkenntnisgewinn dazu dienen könne, die Therapie und die Therapieplanung mit dem Mittel „optimaler für Arzt und Patient zu gestalten“. Angaben zu Projektkosten und Honoraren macht Bayer nicht.
Pharma-Industrie kündigt Transparenz-Offensive an
Dabei hat die Pharma-Industrie für dieses Jahr eine große Transparenz-Offensive angekündigt. „Durch Transparenz bei der Zusammenarbeit wird bereits der Anschein von Interessenkonflikten im Ansatz vermieden“, heißt es auf der Seite „pharma-transparenz.de“ der Freiwilligen Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie (FSA), wo auch Bayer und Roche Mitglied sind. Patienten sollten Informationen darüber erhalten, in welchem Umfang und welche Kooperationen zwischen ihren behandelnden Ärzten und Pharma-Unternehmen bestehen. In den kommenden Monaten sollen deshalb alle Zuwendungen an Ärzte und medizinische Einrichtungen aus dem Jahr 2015 veröffentlicht werden. Bei einem Verstoß sollen Geldstrafen verhängt werden können.
Bislang scheint sich der Transparenz-Gedanke aber noch nicht herumgesprochen zu haben – auch andere Unikliniken haben auf Anfragen zu Anwendungsbeobachtungen dürftig geantwortet. Von den norddeutschen Unikliniken lieferte nur die Greifswalder konkrete Angaben. Zwischen 2013 und 2015 seien dort insgesamt 20 Anwendungsbeobachtungen gelaufen, mit Einnahmen von etwa 65.000 Euro. Die Universitätsmedizin Rostock dagegen teilte nur mit: „Wir nehmen an Anwendungsbeobachtungen teil.“ Eine Zahl beziehungsweise eine Liste der Studien könnten unter anderem aus Datenschutzgründen jedoch nicht zur Verfügung gestellt werden. Auch andere große Unikliniken in Deutschland, die exemplarisch angefragt wurden, sagten, sie könnten keine genauen Angaben machen. Teils begründeten sie dies mit dem hohen Aufwand.